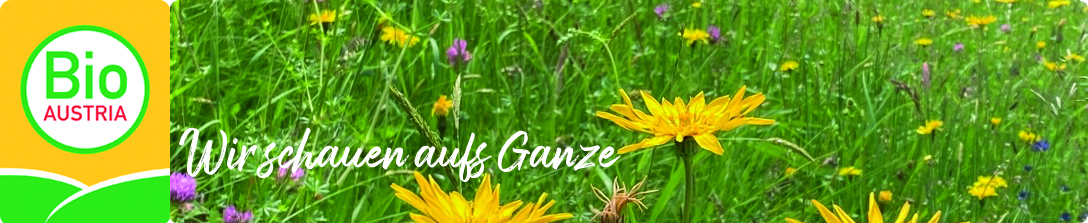Gedanken zu „Grundsätze der Biologischen Landwirtschaft“ beginnen zwangsläufig mit jenen über Bodenfruchtbarkeit.
Die Bodenfruchtbarkeit kann man nicht mit dem Düngersack kaufen! Zu dieser Erkenntnis kommen immer mehr Landwirte.
Kreisläufe schließen
Bereits Justus von Liebig beschäftigte sich mit einer konsequenten Kreislaufwirtschaft von Mensch und Tier, und forderte z.B. die Rückführung der Fäkalien auf den Boden. Kreislaufwirtschaft ist ökologisch und ökonomisch: Organische Substanz und Nährstoffe werden dem Boden zurückgeführt, der Boden bleibt somit in seiner Fruchtbarkeit stabil. Die Ersparnisse durch den nur in geringerem Maße notwendigen Betriebsmitteleinkauf wirken sich auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebes unmittelbar aus. Um Stoffkreisläufe im Betrieb in Gang zu halten, bedarf es eines sorgfältigen Betriebsmanagements, um Verluste möglichst gering zu halten. Als Beispiele können die Hofdüngerwirtschaft, die Düngepraxis, die Erntetechnik und der Umgang mit pflanzlichen und tierischen Abfällen auf dem Betrieb angeführt werden.

Die Würde der Tiere
Dem Grundsatz der Kreislaufwirtschaft entsprechend werden nicht mehr Tiere auf dem Biobetrieb gehalten, als davon ernährt werden können. Tiere sollen hauptsächlich in jenen Regionen gehalten werden, in denen deren Futter auch produziert werden kann. (Das schließt nicht grundsätzlich aus, dass ein Betrieb im Grünlandgebiet den Betriebszweig Geflügel- oder Schweinehaltung betreibt, die Futtergrundlage für den Hauptbetriebszweig muss dennoch aus dem eigenen Betrieb stammen.)
Damit werden Transportkosten gespart und Nährstoffungleichgewichte, zu starker Nährstofftransfer von einer Region in eine andere möglichst vermieden.
In der Intensivtierhaltung können Tiere ihre arteigenen Verhaltensweisen oft nicht mehr ausleben.
Ganzjährige Anbindehaltung bei Rindern ohne Auslauf entspricht nicht den Grundsätzen einer artgerechten und artgemäßen Tierhaltung, da Rinder ein ausgeprägtes Bewegungs- und Sozialverhalten haben.
Werden derartige Verhaltensweisen in der Nutztierhaltung missachtet, kommt es gezwungenermaßen zu mehr oder minder ausgeprägten Verhaltensstörungen oder Krankheiten.
Die Biologische Landwirtschaft bietet den Tieren daher Stall- und Außenflächen an, die das Ausleben ihres arteigenen Verhaltens und entsprechende Bewegungsmöglichkeiten zulassen.
Nutzung natürlicher Ressourcen
Sind Grundsätze der Biologischen Landwirtschaft beschrieben, darf die lebensspendende Arbeit der Rhizobien nicht fehlen! Durch den regelmäßigen Anbau von Leguminosen wird Luftstickstoff in den Stoffkreislauf eingebracht. Durch Optimierung des Fruchtfolgesystems können selbst im viehlosen Ackerbaubetrieb ausgeglichene Stickstoffbilanzen erreicht werden.
Ein kg synthetischer N-Dünger benötigt für seine Herstellung die Energie von ca. 2kg Öl. Diese fossile Energie wird im Biolandbau durch den Verzicht auf diese Dünger gespart!
Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energie ist natürlich keine Frage der Landwirtschaft, sondern der ganzen Gesellschaft, dennoch hat die biologische Landwirtschaft Chancen und Verantwortung, auch auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle einzunehmen.
Auch Biolandbau kann nicht ohne Stickstoff funktionieren – mithilfe der Natur kann sich der Biobauer N aber selbst besorgen!

Auch bei Phosphor und Kali sind die Bodenvorräte größer als die Lagerstätten.
Die Herausforderung für den Biobauern ist das optimale Düngemanagement bzw. das Verfügbarmachen der Nährstoffe für die Pflanzen.
Eine ausgeglichene Bereitstellung von Pflanzennährstoffen kann ohnedies nur über den puffernden Humus und ein aktives Bodenleben gewährleistet werden (siehe Nährstoffdynamik).
Markus Danner