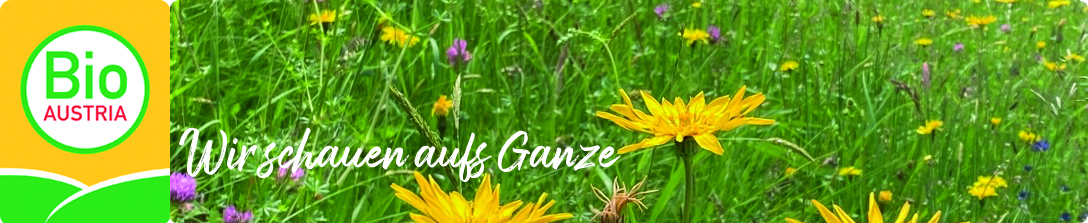In den letzten Jahrzehnten hat sich aus arbeitstechnischen Gründen und vermehrten Umstiegs auf Laufstallhaltung auf vielen Betrieben die Güllewirtschaft etabliert.
Auch deshalb gilt es, alles zu unternehmen, um aus Gülle einen auch in der biologischen Grünlandwirtschaft brauchbaren Dünger zu machen. Gülle und Jauche auf Bioflächen darf und muss kein gesellschaftliches No-Go sein.
Unbehandelte Gülle ist in den meisten Fällen nicht boden- und pflanzenverträglich!
Diese Verträglichkeit muss durch entsprechende Behandlung erst geschaffen werden.
Aufbereitungsmöglichkeiten
Die Güllebelüftung ist keine unheikle Angelegenheit. Ein Zuviel bewirkt Verluste durch Ausblasen von Stickstoff und Schwefel mit gleichzeitiger Belastung von Luft und Umwelt.
Das Ziel hingegen soll möglichst verlustfreier Erhalt der Stoffe im Kreislauf sein.
Ein Zauberwort heißt, nach neuesten Erkenntnissen: Mikroaerobes Milieu!
Das heißt, leichter Sauerstoffeintrag in die Gülle bewirkt eine Hygienisierung, denn ein Großteil der pathogenen Keime ist nicht sauerstofftolerant und sie verschwinden dadurch.
Gleichzeitig lässt vorhandener Sauerstoff Mikrobentätigkeit zu, welche Voraussetzung ist, Stoffe organisch zu binden (N, S).
Dadurch wird die Gülle bodenverträglicher und bei der Ausbringung treten deutlich weniger Verluste auf!
Eintrag von Urgesteinsmehl oder Tonmineralen
Die Verwendung von Urgesteinsmehl, direkt in die Grube eingeblasen oder im Stall ausgestreut, nimmt gegenwärtig zu, nicht zuletzt auch aufgrund der Einfachheit seiner Anwendung, denn der Arbeitsaufwand im Falle des Einblasens lässt sich auf ein bis zwei Einsätze im Jahr reduzieren.
Zu beachten ist unbedingt, dass der Trockensubstanzgehalt der Gülle nicht weit weniger als 7% beträgt, da ansonsten das Steinmehl zu wenig anhaften und einen Bodensatz bilden kann. Bei Vollgülle mit einer Verdünnung bis max. 25% haften die zuvor intensiv eingemixten Steinmehlpartikel an den Feststoffteilchen der Gülle dauerhaft an und bleiben in Schwebe.
Tonminerale sind höchst oberflächenaktiv, auch deshalb liegt die Aufwandsmenge deutlich niedriger als jene des Steinmehls.
Steinmehl: ca. 25-30kg/m3
Tonminerale: ca 25kg/GVE/Jahr
Ziel und Zweck:
- Bindung flüchtiger Stoffe durch die hohe Absorbtionskraft
- Anregung mikrobieller Tätigkeit
- Entgiftung der Gülle
- Eintrag der mineralischen Komponente
- Ausbringung auf den Boden erfolgt durch die Gülledüngung ohne zusätzlichen technischen Aufwand
Die Verdünnung ist eine weit verbreitete Praxis. Sie erfolgt vor allem durch die Ableitung von Oberflächenwasser aus befestigten Auslaufflächen.
Auch Dachwasser wird gelegentlich in die Grube eingeleitet. Positiv wirkt sich die Wasserzugabe durch den damit verbundenen Sauerstoffeintrag in die Gülle aus, zudem bietet das Wasser Reaktionsoberfläche, an die sich Stoffe binden können und dadurch weniger emissionsgefährdet sind (v.a. Ammoniak).
Gülle und Jauche auf Bioflächen
Darf nicht so aussehen! Damit schaffen wir uns gesellschaftliche und betriebswirtschaftliche Probleme!

Durch die Verringerung des Trockensubstanzgehaltes wird die Homogenisierung und Belüftbarkeit erleichtert. Werden keine sonstigen Behandlungsmethoden angewandt, ist die Wasserzugabe zur Verringerung der Stickstoffverluste unbedingt notwendig.
Die Verdünnung ist aber nicht unbegrenzt sinnvoll, denn der Energieaufwand der Ausbringung steigt selbstverständlich mit jedem Fass, das zusätzlich ausgebracht werden muss.
Auf keinen Fall darf die Verdünnung der Gülle dazu führen, dass die ausgebrachten Einzelgaben pro Flächeneinheit über die verträgliche Menge steigen. Dies würde unweigerlich Schäden an Feinwurzeln, Regenwürmern und anderen Bodenorganismen nach sich ziehen
Komm oft, bring wenig!
Ausbringungsmenge:
Einzelgabe Grünland: 12m3
Einzelgabe Acker: 20m3
Jahresmenge: abhängig von der Nutzungsintensität
Um Schwimm- und Sinkschichten zu vermeiden, ist eine regelmäßige Durchmischung bzw. mixen eigentlich selbstverständlich, auch viele Schadorganismen werden dadurch ferngehalten (Fliegen, Rattenschwanzlarven, Ratten..), die auf Schwimmdecken paradiesische Verhältnisse vorfinden.
Durch regelmäßige Bewegung der Gülle wird durch den Oberflächenkontakt zur Luft ein gewisser Sauerstoffeintrag ermöglicht, der u.U. die gewünschten Effekte schon allein dadurch erbringen kann. Weitere Zusatzstoffe jeglicher Art werden sehr unterschiedlich beurteilt, gute und schlechte Erfahrungen halten sich die Waage.
Wichtig ist in jedem Fall, für sich ein Maßnahmenziel zu formulieren, und die Zielerreichung durch die jeweilige Maßnahme kritisch zu hinterfragen und zu prüfen.
Markus Danner