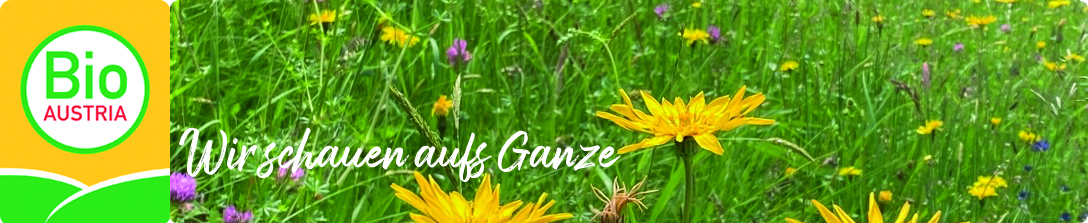www.bodenoekologie.com
Bodenfruchtbarkeit
Analysieren – Bewerten – Optimieren
Mach deinen Boden klimafit!
Den Boden anders betrachten!
Die Themen Bodenfruchtbarkeit und „Klimafitness“ von Böden stehen bei uns im Zentrum der Betrachtung.
Wir müssen uns folgende Fragen stellen:
- Ist mein Boden fit für die Herausforderungen der Witterungsextreme?
- Kann mein Boden passiven Hochwasser- und aktiven Grundwasserschutz leisten?
- Geht es dem Bodenleben gut? Was könnte ich verbessern?
- Wie schaut das Nährstoffspektrum im Boden aus?
- Können Nährstoffe mobilisiert werden?
- Müssen Nährstoffe zugeführt werden?
- Wie kann das Puffersystem gestärkt werden?
- Welche Kalke sind die richtigen?
Wir untersuchen und bewerten Böden nach dem weltweit einzigartigen Verfahren der
„Fraktionierten Analyse“. Eine Bodenuntersuchung, die weiter geht!
Dabei werden 118 Einzelparameter der Bodenprobe zur Charakterisierung der Bodenfruchtbarkeit gemessen. Die Stoffe werden in den verschiedenen Verfügbarkeitsstufen
wasserlöslich (sofort verfügbar),
austauschbar (über die Vegetationsperiode verfügbar) und
Reservepool (durch bestimmte Maßnahmen mobilisierbar)
bestimmt.

Den Verhältnissen der Nährstoffe wird eine ganz besondere Bedeutung beigemessen, die Absolutgehalte dagegen rücken in den Hintergrund.
Durch die umfangreichen Basisparameter (z. B. pH Werte, Organischer Kohlenstoff, C/N, Austauschkapazität,…) können die Milieubedingungen für die biologische Aktivität abgeschätzt werden.
Dadurch erhältst du die Grundlagen zur Optimierung der Pflanzenernährung und zur Aufrechterhaltung bzw. Optimierung der Bodenfruchtbarkeit.
mehr dazu auf www.bodenoekologie.com