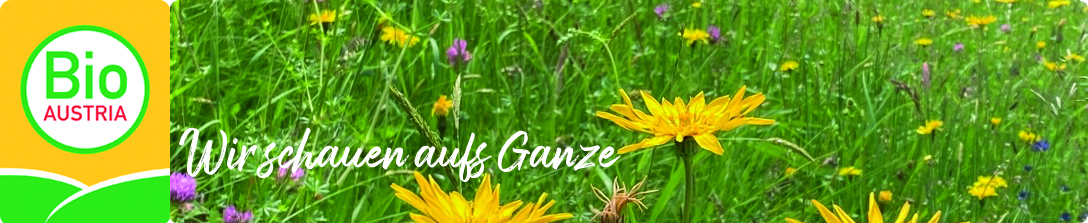Die Umstellungszeiten von Rindern hängen von verschiedenen Umständen ab. Im wesentlichen gibt es zwei Varianten.
Ein Kontrollvertrag mit einer zertifizierten Kontrollstelle ist in jedem Fall Grundvoraussetzung. Mit dem Vertragsabschluss bzw. Tierzugang auf den Betrieb beginnt die Umstellungszeit zu laufen.
Berechne den Status deiner Tiere mit diesem Werkzeug!
Variante 1. Ganzbetriebsumstellung in zwei Jahren
Ab Datum Abschluss Kontrollvertrag dauert die Umstellungszeit zwei Jahre.
Nach Ablauf der zwei Jahre ist der komplette Betrieb umgestellt, dass heißt sowohl alle Tiere als auch die Flächen.
Während der Umstellungszeit müssen sowohl die Haltung als auch die Fütterung den Biorichtlinien entsprechen.
Nach Ablauf der Umstellungszeit darf der Betrieb nun seine Milch (-produkte), Rinder bzw. Fleisch sowie Grundfutter biologisch vermarkten.

bin ich schon „BIO“ oder noch nicht?
Variante 2. Produktspezifisch verkürzte Umstellung in 6 Monaten
Besonders für Betriebe, deren Fokus auf der Milchproduktion und weniger auf der Rinder- und Fleischvermarktung liegt, kann diese Umstellungsvariante interessant sein.
Unter gewissen Voraussetzungen kann die Umstellungszeit für die Milch von 2 Jahren auf 6 Monate verkürzt werden, die Umstellung des Tieres selbst ist davon jedoch nicht betroffen. Siehe „Verkürzte Umstellungszeiten“.
Dass bedeutet: Sechs Monate nach dem Kontrollvertragabschluss kann die Milch als Bioprodukt vermarktet werden, die Umstellung jedes einzelnen Rindes (Fleisch) beträgt jedoch immer mindestens 12 Monate und ¾ des Lebens.
Die Umstellungszeiten von Rindern nach Variante 2 sind wiederkehrend Anlass für Ärger und Sanktionen, weil es für die Betriebe nicht einfach ist, den Überblick zu behalten, wenn jedes Tier ein anderes Konformitätsdatum hat!
Die Umstellungszeiten von Rindern :
Beispiele
Biobauer Huber kauft auf der Versteigerung eine konventionelle, trächtige Kalbin (siehe Ausnahmen beim Tierzukauf). Ab diesem Tag beginnt die Umstellungszeit der Kalbin zu laufen (6 Monate für die Milch, 12 Monate bzw. mind. ¾ des Lebens für Fleisch).
Einen Monat nach dem Kauf kalbt die Kuh am Biobetrieb. Nun verbleiben noch 5 Monate, bis die Milch der Kuh als Biomilch geliefert werden darf. Biobauer Huber muss nun dafür sorgen, dass während dieser Zeit die Milch dieser Kuh nicht in Verkehr kommt. Das Verfüttern der Milch an Kälber ist erlaubt.
Nach weiteren 5 Monaten darf die Milch als Biomilch an die Molkerei geliefert werden. Die Umstellungszeit für das Fleisch läuft jedoch noch. Angenommen, die Kuh war zum Zeitpunkt des Kaufes exakt 28 Monate alt, so muss sie 84 Monate (7 Jahre!!) am Biobetrieb bleiben, bis sie als biologisch vermarktet werden darf.
Die ¾ Regelung
Sowohl im Falle der verkürzten Umstellung als auch bei Zukäufen von konventionellen Tieren (Ausnahmefälle) tritt die ¾ Regelung in Kraft.
Laut dieser Regelung dauert die Umstellung des einzelnen Tieres mindestens 12 Monate und es muss zusätzlich mindestens drei Viertel seines Lebens auf dem Biobetrieb verbracht haben.
Erst wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, darf das jeweilige Rind biologisch vermarktet werden.
Die ¾ Regelung gilt immer nur für das einzelne Tier. Das bedeutet im Fall einer verkürzten Umstellung, dass für jedes Tier separat berechnet werden muss, ab wann es den Biostatus erfüllt.
Beispiel: Bauer Gruber will Biobauer werden und wählt die Variante der verkürzten Umstellung.
Also darf er bei Erfüllung der Voraussetzungen für die Flächenumstellung sechs Monate nach dem Abschluss des Kontrollvertrages die Milch als Biomilch vermarkten.
Kuh Resi ist am Tag, als der Kontrollvertrag abgeschlossen wurde, exakt 3 Jahre alt. Das heißt, sie ist 3 Jahre lang konventionell gehalten worden. (=1/4) Nun muss sie mindestens ¾ ihres Lebens – also 9 Jahre – am Biobetrieb bleiben, bis sie als biologisch verkauft bzw. vermarktet werden darf!
Bei dieser Umstellungsvariante wird über die Jahre oft der Überblick verloren! Es kommt laufend zu Sanktionen wegen Falschkennzeichnung!
Unbedingt zu empfehlen: Jedes Tier im Verzeichnis mit seinem „konventionellen Ablaufdatum“ versehen, dann kann beim Verkauf nicht viel passieren.
Verwende dazu den Statusrechner weiter oben!
Franz Promegger
Markus Danner