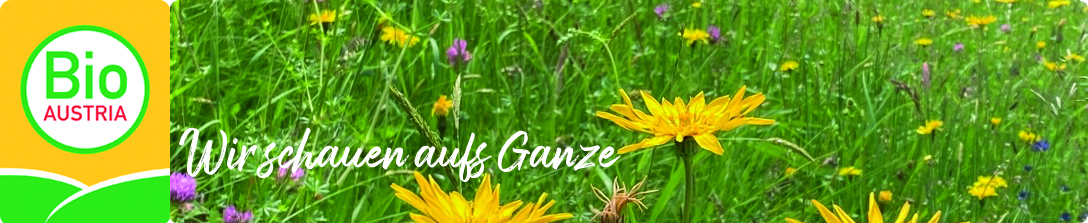Eine regionale Bio Getreidesorte stellt sich vor.
Seit etwa zehn Jahren wird im Salzburger Flachgau, dem Innviertel und der anderen Salzachseite in Bayern eine alte Landweizensorte, der „Laufener Landweizen“, wieder vermehrt und angebaut.
Der Anstoß kam vom Bio Austria Betrieb Eisl aus St. Georgen und dem BioBäcker Itzlinger aus Faistenau, der für seine Gebäckspezialitäten immer für ursprüngliche, von Massenware unterscheidbare, lokale und regionale Herkunft offen war. So wurde aus einer Handvoll Körnern eine kleine Vermehrungsgrundlage für einen kleinen, dann einen größeren Acker.
Inzwischen wird der Landweizen von 13 Betrieben angebaut. Die Ernte wird von zwei Mühlen und 5 Bio-Bäckern, alle Kooperationspartner von Bio Austria, in Mehle und Brote veredelt. Von Anbeginn dabei war auch das Gut Eiferding bzw. Biergut Wildshut der Stiegl Brauerei, die Landweizen anbauen, vor Ort vermälzen und in die Bio Spezialbiere integrieren.
Grenzüberschreitende Kooperation zu Beginn
Ursprünglich koordinierte die ANL in Laufen (Bayern) für die bayrischen Bauern, und Markus Danner, Bio Austria Salzburg für die österreichischen Betriebe die Nachfrage nach Saatgut einerseits, nach dem Produkt und dessen Aufbringung andererseits.
Der Rückzug der ANL und die fehlende Koordination auf bayrischer Seite führte dazu, dass wir uns fortan auf die Entwicklung in Salzburg/Oberösterreich konzentrierten.
Die Fäden laufen im Bio Austria Büro in Seeham zusammen, Besprechungen, Saatgutbedarf und -anbau, die Saatgutaufbereitung, Anbauflächen und Bereitstellung der Ware für die Verarbeiter werden zentral koordiniert.
Laufener Landweizen – was ist das Besondere daran?
Worin liegt die Motivation, dieses Getreide anzubauen, zu verarbeiten, zu essen?
Die Lokalsorte wurde nachweislich über lange Zeit und vor langer Zeit im Rupertiwinkel, Chiemgau, Traunsteiner und Berchtesgadener Land und im Salzachtal hüben und drüben der Salzach angebaut.
Im Labor wurde seinen Besonderheiten nachgespürt. Dabei ergaben sich Hinweise für eine sehr geringe allergene Wirkung. Tatsächlich reagieren diesbezüglich empfindliche Personen oftmals nicht oder kaum auf Produkte aus dieser Weizensorte. Ein entsprechender Hinweis auf den Produkten ist rechtlich natürlich nicht zulässig.
Das Getreide hat aber noch mehr zu bieten.
Optisch ein Blickfang und Genuss: Gelbgrün im Schossen wie ein Gerstenfeld, reift der Weizen in ein weithin leuchtendes kupferrot ab. In Verbindung mit seiner Eigenschaft, nicht allzu stark zu bestocken, dadurch Licht zum Boden zu lassen, bilden diese Kulturen eine Mischkultur mit etlichen (z.T. selten gewordenen) blühenden Acker-Beikräutern.
Sein hoher Wuchs garantiert einen meist üppigen Strohertrag. Für tierhaltende Gemischtbetriebe ist dies ein nicht unwesentlicher Zusatznutzen.





Herausforderungen beim Start
Der wiederholte Nachbau des Weizens, ohne Qualitätskontrolle sozusagen, führte dazu, dass kein gesundes, qualitativ hochwertiges Saatgut zur Verfügung stand.
Jede Charge musste auf Steinbrand untersucht werden, bevor entschieden werden konnte, welche sich überhaupt eignet, als Saatgut in Frage zu kommen.
Durch strenge Selektion, Fruchtfolge und professionelle Saatgutaufbereitung steht inzwischen qualitativ hochwertiges Saatgut für den Anbau zur Verfügung.
Das anfängliche, nicht ganz rechtskonforme „Weitergeben“ von Betrieb zu Betrieb ist mittlerweile in eine Anerkennung und offizielle Saatgutregistrierung durch die AGES übergegangen.
Die Salzburger Biobäcker entwickelten Brotsorten, teilweise unter großen Herausforderungen, denn „alte“ Getreidesorten funktionieren anders als standardisierte, auch und vor allem in der Teigwanne.
Die Lerchenmühle in Golling übernahm die Bereitstellung der Mehle für die Bäcker, gemeinsam kreierten wir eine Verpackungslinie für die Produkte.
Einen „Projektplan“ hatten wir bis dahin nicht, einige Hektar wurden angebaut, ein paar Bäcker wollten das Produkt verarbeiten, ein paar Läden nahmen den Weizen in ihr Sortiment regionaler Bioprodukte auf. Soviel zur Verfügung stand, soviel wurde an den Mann/die Frau gebracht.
Weitere Produzenten und die Hochmühle in Plainfeld als Verarbeiter/Vermarkter verstärkten unsere Gruppe der Landweizen-Fans, wurden verlässliche Partner und halfen dem Projekt in der Weiterentwicklung.
Wie bringt man mehrere Bauern unter einen Hut?
Die Frage, in welcher organisatorisch-rechtlichen Form so ein Projekt begonnen und betrieben wird, stellte sich natürlich gleich zu Beginn und auch gegenwärtig.
Würden gerne Betriebe von außerhalb von Bio Austria mitmachen, sehen wir das als kontraproduktiv an.
Denn einerseits soll es ein Bio Austria Projekt sein, das wir gemeinsam entwickeln, betreiben und bewerben, andererseits ist es nicht vermittelbar, dass angestellte und bezahlte Mitarbeiter des Bioverbandes Nicht-Mitglieder auf Dauer mitbetreuen und deren Ware integrieren.
So verloren wir unterwegs den einen oder anderen, der partout nicht Familienmitglied werden wollte.
Das Projekt ist aber nach wie vor offen für zusätzliche Produzenten und natürlich auch Verarbeiter. Auf möglichste Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage wird aber sehr genau geachtet.
Es wurde kein Verein, keine Genossenschaft, keine Interessens- oder Erzeugergemeinschaft gegründet. Die Produzenten werden in unregelmäßigen Abständen erinnert, ihre Ernteerwartungen, Saatgutbedarf etc. bekanntzugeben, und keine Verkäufe zu tätigen, die nicht abgesprochen sind. Dadurch konnten störende Querschüsse bislang großteils verhindert werden.
Eine Bedarfs-Abfrage bei den Verarbeitern legt den Rahmen für die Zuteilung der produzierten Menge zum Verarbeiter fest. Mit diesen Informationen im Gepäck werden die Produzenten zur Besprechung geladen.
Diese findet im Sommer statt. Es wird geklärt, welche Erntemenge von wem für welchen Abnehmer mengenmäßig am besten passt und wieviel im Herbst angebaut werden soll, um keine Überschüsse auf Lager legen zu müssen, die Bedarfe aber bestmöglich zu erfüllen.
Diese unkomplizierte Art der Zusammenarbeit funktioniert bislang und lässt auch noch ein gewisses Wachstum des Projekts zu, solange alle Beteiligten „das letzte Wort“ des Projektkoordinators im Bio Austria Büro akzeptieren und respektieren und Alleingänge möglichst unterlassen.
Saatgutqualität ist entscheidend
Die Erzeugung von sortenreinem Saatgut ist eine Herausforderung, die zu bewältigen Sorgfalt, sehr gute landwirtschaftliche Praxis und Verlässlichkeit erfordert. Für diese Aufgabe zeichnet der Pichlerbauer in St. Pantaleon hauptverantwortlich. Sollte die Menge nicht ausreichen bzw. Wetterkapriolen (Hagel, Unwetter..) die Ernte schädigen oder zerstören, ist sicherheitshalber der Acker eines zweiten Betriebs zur Anerkennung angemeldet. Aufgrund der ausgezeichneten Arbeit auf den Betrieben ist es gelungen, die Qualität nicht nur sicherzustellen, sondern laufend zu verbessern und auf ein hohes Niveau zu heben.
Engpässe, organisatorische Hürden
Hürden laden prinzipiell dazu ein, übersprungen zu werden. Unerwähnt dürfen sie trotzdem nicht bleiben.
Ein größeres Manko im Salzburger Flachgau und Oberen Innviertel ist die kaum (mehr) vorhandene Getreide-Infrastruktur auf den Betrieben.
Die Arbeitsteilung der letzten 60, 70 Jahre in Hörndlbauern im Westen und Körndlbauern im Osten hat die meisten Betriebe von Lagermöglichkeiten und Aufbereitungstechnik leergeräumt.
So ist nach dem Dreschen durchaus zu hören: „Und wohin soll ich jetzt mit dem Kipper fahren, den brauch ich übermorgen für etwas anderes.“
Ein gemeinsames Lager hat auch Konsequenzen. Es ist mitunter schwer zu vermitteln, dass Getreide, welches in einen Silo zu anderer Leute Ware gekippt wird, nicht mehr dem Lieferanten „gehört“, sondern die nächsten Schritte der Qualitätssicherung und Verantwortlichkeiten erfordern.
Diese Aufgabe könnten bestenfalls die Partner-Mühlen übernehmen. Aber auch die haben überschaubare Lagerkapazitäten. Vor allem für Chargen in Kleinmengen – letztlich ist dieses Projekt ein Kleinmengenprojekt – ist die Lagerungsfrage eine nur unbefriedigend beantwortete.
Aus diesem Grund wird die Ernte möglichst binnen Wochen an die Verarbeiter ausgeliefert und nicht oder in nur sehr geringer Menge auf Lager produziert.
Und ein Grundsatz begleitet alle Überlegungen: Wenig Kosten, viel Wertschöpfung für den Betrieb.
Ertrag, Wert und Preis
Der Ertrag liegt im Schwankungsbereich jenes von Dinkel. Zwei bis bestenfalls dreieinhalb Tonnen Hektarertrag sind, je nach Standortbedingungen und den Verhältnissen der Wachstumsperiode entsprechend zu erwarten.
Der (Mehr-)Wert liegt in seinen Eigenschaften, wie oben beschrieben.
Verrechnet wurden die letzten Jahre stabil und kontinuierlich € 1,1 bis 1,2 netto pro Kilo. Wurde in preisschwachen Jahren („vor Corona“) seitens der Abnehmer keine hartnäckige Preisdiskussion angezettelt, konnten sich die Produzenten in der Teuerungsphase revanchieren und ihrerseits den Verarbeitern durch unterlassene Preissteigerung eine Weiterentwicklung ermöglichen.
Die Mengen stiegen in den letzten Jahren auf bescheidenem Niveau kontinuierlich. Im vergangenen Sommer ernteten wir 75 Tonnen. Der Herbstanbau lässt erwarten, bei guten Bedingungen und Wetterglück an die 100 Tonnen Erntemenge im Jahr 2024 heranschnuppern zu dürfen.
Das Interesse der Verarbeiter, die Wertschöpfung und der Mehrfachnutzen des Produkts eröffnen durchaus Entwicklungsmöglichkeiten, die genutzt werden wollen.
2023
Markus Danner