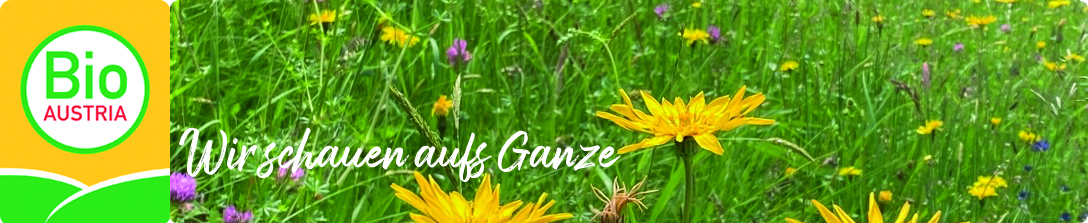ein persönlicher Kommentar von Markus Danner
Zwischenfälle auf Almen zwischen Mensch und Rind sind in den letzten Jahren häufiger geworden. Der Fall in Tirol mit anschließendem Urteil bzw. Verurteilung des Rinderhalters ließ die Wogen hochgehen. Vom Ende der Almwirtschaft mit all seinen Folgen war die Rede.
Aber: Sind Almen gefährlich?
Ein amtsbekannter Tierschützer glaubt sich nun bestätigt und blogt, „Almen töten Menschen“. „Almen verletzen Menschen“. „Almen sind grauenhaft“.
Grundsätzlich sollte nicht auf jeden Unsinn reagiert werden, schon gar nicht, wenn er wie in diesem Fall so haarsträubend Tatsachen verdreht. Ein Kommentar zu dieser Thematik im Allgemeinen scheint aus persönlicher, biobäuerlicher Perspektive dennoch nicht unangebracht.
Stichwort „biobäuerlich“: Ich habe mich als Biobauer bzw. als im Biolandbau tätiger Mensch Zeit meines Lebens als Tier- und Naturschützer empfunden. Ich bin seit jeher Kritiker der um sich gegriffenen Entwicklungen in der industrialisierten Landwirtschaft. Ich war nie gefährdet, klientelfreundliche Meinungen der Klientel wegen zu vertreten. Umso befremdlicher wirkt es auf mich, wenn völlig ahnungslose Träumer, die doch recht zahlreich geworden sind, Forderungen erheben, die lebensfremder nicht sein könnten:
Schluss mit Tierhaltung! Das Gras der Wiesen zur Energiegewinnung in die Biogasanlagen.
Freie Fahrt für freie Mountainbiker auf allen alpinen Wegen! Aber wenn`s uns auf die Schnauze haut, zahlst du, verantwortlicher Wegerhalter, Schmerzensgeld. Alle Tiere auf die Weide, aber drei Minuten warten, weil eure Viecher die selbe Straße nutzen wie ich – kommt nicht in Frage!
Und: Die Hunde müssen sich doch irgendwo austoben können, was macht das schon in einer Wiese. Nun: Die Wiese gehört ihm einfach nicht, dem Typen am anderen Ende der oft nur imaginären Leine.
Und das muss verboten werden, und dies muss verboten werden. Aber den Preis bezahlen wir nicht.
Die Alm damals und jetzt
In den 70er und 80er Jahren waren auch schon zahlreiche Wanderer auf Almen unterwegs. Von Zwischenfällen mit Tieren war eigentlich nie zu hören.
Was hat sich verändert? Einerseits sind wir zwischenzeitlich eine Informationsgesellschaft geworden. Hat sich damals ein mutiger Bub an ein dösendes, wiederkauendes Jungrind geschlichen, um ihm auf den Rücken zu springen, so konnte er seinen Abflug nach den Ferien seinen Freunden in der Schule erzählen. Heute liken das ein paar Hundert innert Minuten in den Online-Medien. Oder es empören sich ebensoviele.
Mensch und Tier sind anders geworden
Andererseits sind inzwischen die Menschen und die Tiere anders geworden.
Die Menschen strömen zu Tausenden überallhin, im Bewusstsein der absoluten Rechtmäßigkeit und zu Hundert Prozent vollkaskoversichert. Der Rechtsstaat gibt`s her, keine noch so große Unverschämtheit hat nicht das Recht, das Gericht anzurufen, um die Verantwortung an andere zu übertragen.
Die Tiere sind anders geworden. Sie kommen nicht mehr ausschließlich aus Ställen, in denen sie mit ihren Betreuern nahezu täglich physisch in Berührung kamen.
Mutterkuhherden in „Selbstversorgerställen“ entwickeln eine ganz andere Verhaltensdynamik als Milchkühe aus Anbindehaltung, die händisch geputzt wurden, zum Melken angesprochen, angefasst, zur Seite geschoben, sprich — mit der ein Mensch täglich für mehrere Minuten interagiert hat.
Auch das Jungvieh auf Almen ist teilweise deutlich weniger menschenaffin.
Und Hunde, ja Hunde trafen vor Jahrzehnten auch weniger auf das grasende Rindvieh der Almen wie heute.
Vor allem aber weiß der Großteil der Freizeitmenschen heutzutage nicht mehr, wie sie sich abseits ihrer technisierten Vollkaskowelt verhalten sollen.
So ist die Zunahme an unangenehmen Begegnungen auf Almen ebenso logisch und unausweichlich wie jene von E-Bike Unfällen.
Almen töten nicht
Aber, um auf den Punkt zu kommen: Keine Alm hat jemals jemanden getötet. Ums Leben kommen Leute aufgrund ihrer Aktivitäten, aufgrund unglücklicher oder tragischer Umstände. Weil sie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort sind. Aus Leichtsinn, Selbstüberschätzung oder Pech. Aber sicher nicht, weil sie von einer Alm umgebracht wurden.
Almen vermehren auch nicht Naturkatastrophen!
Lawinenabgänge sind so selbstverständlich wie Schneefall im Hochgebirge. Dafür sorgt die Topographie, das Wetter und die Gravitation. Der Mensch wiederum ist es, der sich, sofern er zu Schaden kommt, der Gefahren bewusst oder nicht, zur falschen Zeit an den falschen Ort begibt.


Almböden sind nicht immer, aber oft gute Wasserspeicher. Sie absorbieren umso mehr Niederschlag, je größer der Humusgehalt. Den Humusgehalt fördert einerseits die Weidenutzung, andererseits der Mist der Weidetiere.
Wasserquellen sind trotz der Weidetiere sauber und herrlich frisches Trinkwasser. Sind sie es nicht, stimmt an der Bewirtschaftung einiges nicht und die Ursachen sind sofort abzustellen. Selbstverständlich gibt es wie überall, wo Menschen zugange sind, auch auf der einen oder anderen Alm Missstände. Das soll aufgezeigt und umgehend abgestellt werden. Überbesatz kommt nur mehr sehr selten vor. Bauern schicken ihre Tiere nicht mehr auf die Alm, nur damit sie auf dem Heimbetrieb kein Futter brauchen. Sie legen Wert darauf, dass die Tiere gut konditioniert nach Hause kommen. Dazu muss die Weidequalität und -quantität der Almen in Ordnung sein.






Die Almwirtschaft ist Kulturgut
Jahrhunderte und Jahrtausende bewirtschaften Menschen alpine Regionen. Ja, sie haben dadurch Kulturlandschaft geschaffen. Für sich. Nicht für Wölfe oder Bären, einfach für sich und ihr Überleben.
Unter nicht wirklich einfachen Umständen. Nebenbei ist dadurch eine enorme Biodiversität entstanden, pflanzlicher und tierischer Art.
Sollen Ethiker und Philosophen debattieren, ob das so rechtens war. Die Menschen in diesen Regionen hätten ohne diese Landnahme mithilfe der Wiederkäuer jedenfalls keine Lebensgrundlage vorgefunden. Und wir tun es heute noch nicht. Ohne den Wiederkäuer gibt es nicht nur keine Milch- und Fleischprodukte (das ist womöglich manchen Veganers Freude und logisches Ziel), sondern auch keine offene Landschaft, keine Almmatten, keine Wanderwege, keine Schigebiete, keinen alpinen Tourismus (mit Ausnahme des Survival– und Adventure- Individualtouristen). Es gibt ohne Grasnutzung keinen bevölkerten alpinen Raum! Wessen Ziel kann das sein?
Bleibt abschließend die Frage: Lassen wir das mit der Tierhaltung und der Almwirtschaft, welche Hälfte der Bevölkerung soll sich denn nun wohin verabschieden, dem Wald, Wisent und Wolf weichend?