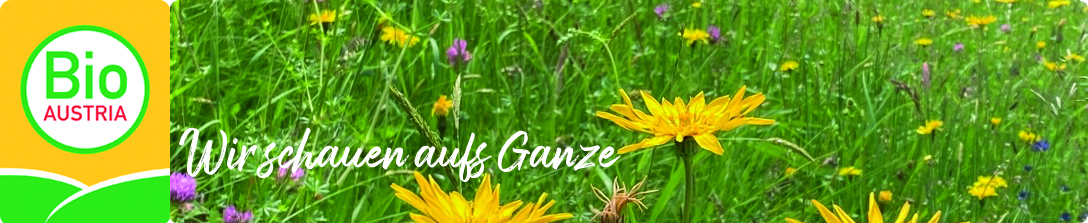Bio- Direktvermarktung
im Rahmen der BIO AUSTRIA Richtlinien, der neuen EU Bio-Verordnung und weiteren Richtlinien.
Jour Fixe, Mittwoch, 2. März, 19.30 Online per Zoom. Wir diskutieren und beantworten Fragen wie:
- Was ist bei der Zertifizierung zu beachten, welche Neuerungen gibt es für die Direktvermarktung in der EU BIO-Verordnung ?
- Was ist ein Bio-Produkt, was ein BIO AUSTRIA Produkt ?
- Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen sind vorgegeben, welche Ziele hat BIO AUSTRIA?
- Die Verwendung des BIO AUSTRIA Logos: Chancen und Herausforderungen
Bei unserem 6. Jour Fixe erörtert euch Regina Daghofer, Beraterin für den Bereich Direktvermarktung bei BIO AUSTRIA Salzburg, was zu beachten ist, wenn ihr als BIO AUSTRIA Mitgliedsbetrieb eure selbst erzeugten Produkte vermarkten wollt.
Der Hintergrund ist ernst, denn es gibt durchaus beabsichtigte Tendenzen, „Bio“ als Premiumstandard unter dem „Regional-Mäntelchen“ verschwinden zu lassen.
Für Fragen und die Diskussion um die Chancen und Herausforderungen der Vermarktung als BIO AUSTRIA Betrieb stehen Euch auch unsere beiden für Direktvermarktung zuständigen Vorstandsmitglieder Christoph Quehenberger, Kleinarl, „Bio aus dem Tal“ und Anton Spitzauer, St. Georgen, „Aglassinger Biobauernmarkt“ zur Verfügung.
Jetzt registrieren bis spätestens 2. März, 14:00 Uhr!
Thema: Bio-Direktvermarktung
Uhrzeit: 2.März.2022 19:30 Online
hier registrieren:
https://zoom.us/meeting/register/tJEpceihqz4oHNLnI2CjlWSP9PESkQ1vIER5
Die Folgenden Gedanken wurden an dieser Stelle am 1.1.2020 veröffentlicht:
Bio Standards und bio-bäuerliche Identifikation
Richtlinien, Auflagen, Verbote, Verpflichtungen, Beschränkungen, Vorgaben, Kontrollen.
Wem hängen sie nicht zum Hals raus.
Die Biobauern müssen sich damit auseinandersetzen, seit es Regelungen gibt.
In der Pionierzeit waren es selbst auferlegte Rahmenbedingungen, mithilfe derer das System BIO definiert wurde. Bald musste und wollte man sich aber gegen Trittbrettfahrer und sonstige Möchtegerne schützen und die Sache wurde „amtlich“.
Nebenbei bemerkt, die Trittbrettfahrer und Möchtegerne sind seither leider nicht weniger geworden.
Der Zusammenschluss zur Interessensgemeinschaft
Zur Verfolgung gemeinsamer Ziele wurden und werden Vereine gegründet. So auch bei den Biobauern. BIO AUSTRIA ist das Ergebnis von Zusammenschlüssen biobäuerlicher Organisationen.
Als solches kümmert sich der Verein um verschiedenste Belange wie z.B. den Aufbau eines Wiedererkennungswertes – in Gestalt des BIO AUSTRIA Zeichens. Auf Höfen, Produkten, Vermarktungseinrichtungen, bei Partnern und in Medien stößt man darauf und erkennt österreichische Biolandwirtschaft wieder.
Wir Biobauern und -bäuerinnen – Eine Marke
In den Aufbau einer Marke investieren Unternehmen Millionen.
Die Marke „BIO AUSTRIA“ hat nicht soviel gekostet. Ist sie den Biobauern vielfach deshalb so wenig wert? Mit ungläubigem Staunen kann und muss vielerorts festgestellt werden, wie die Gemeinschaftsleistung „Markenbildung“ und ein in ganz Österreich und darüber hinaus wohlbekanntes Markenzeichen, von Mitgliedsbetrieben ignoriert wird.

Jede/r kann davon profitieren, jede/r stärkt mit seiner Präsenz als BIO AUSTRIA Bauer und Bäuerin das Ganze. Es ist ein Geben und Nehmen in Einem.
Marken geben Sicherheit. Kauft ein Kunde auf dem Wochenmarkt an einem BIO AUSTRIA gekennzeichneten Stand BIO AUSTRIA gekennzeichnete Produkte, erinnert er sich daran, wenn er nächstens im Supermarkt ein Milchpackerl mit BIO AUSTRIA Logo oder ein sonstiges Produkt kauft. Das Eine wird mit dem Anderen assoziiert. So wird die Marke sukzessive stärker.
Die Realität zeigt oft ein anderes Bild. „Eigene Süppchen kochen“ ist aber noch kein Marketingkonzept.
Flucht vor klaren Absagen an Konventionalisierung
Bio Austria hat zahlreiche Mitglieder verloren.
Durch das Verbot des elektrischen Kuherziehers meinten viele, dieser wäre ihnen wichtiger und verließen den Verein.
Durch die Beschränkung des Kraftfuttereinsatzes auf ein argumentierbares Maß stiegen einige aus. Bio sind sie geblieben.
Durch die BIO AUSTRIA-eigene Weideregelung ergriffen Betriebe die Flucht. BIO sind sie geblieben. Die EU Bio-Verordnung holt sie nun wieder ein.
Seit zwei, drei Jahren ist eine deutsche Düngemittelfirma aggressiv auf dem österreichischen Markt aktiv. Mit Hochglanzprospekt und unwiderstehlichen Produkten und Versprechungen. Schwefel wird künftig unsere Probleme lösen, so der Tenor.
Und auch da gibt es Betriebe, die mit dem Verlassen des Vereins liebäugeln, noch bevor sie sich erkundigt haben, welche Alternativen innerhalb des BIO AUSTRIA Standards zur Verfügung stünden.
Nach kurzer Recherche konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die stickstoffhaltigen Dünger dieser Firma Melassehydrolysat aus China beinhalten.
So wird BIO sicher zum Verkaufsschlager, wenn wir Industrie-Abfälle vom Weltmarkt auf unsere Felder streuen! (Ironie Ende)
Nur ein bäuerlicher Bio-Standard schützt vor solchem Unsinn!
Die Beispiele zeigen auf, dass BIO auf nicht ungefährlichen Pfaden wandelt. Sie zeigen auch, dass der BIO AUSTRIA Standard einen tatsächlich großen Mehrwert zu „EU-Bio“ darstellt, weil sich der Verein mit seinem Regelwerk gegen die Konventionalisierung im Dünge-, Pflanzenschutz- und Tierhaltungsbereich stellt. Weil BIO AUSTRIA die Glaubwürdigkeit des Biolandbaus schützen und erhalten will. Trotz Widersprüchlichkeiten im eigenen Haus.
Diese Interessen hat sonst niemand. Dessen sollten sich die Biobauern bewusst werden. Und dann entscheiden, welcher Weg der zukunftsträchtigere sein wird.

Bodenbeurteilung am Acker © Bio Austria
Rahmenbedingungen müssen definiert und eingehalten werden. Um sie so verträglich wie möglich umsetzen zu können, hat BIO AUSTRIA seinen Servicedienst für die Mitgliedsbetriebe in mehreren Bereichen aufgebaut.
Gemeinsam finden wir jedes Betriebsmittel, das wir brauchen, jede Zutat, jedes Produkt.
Es wird wohl notwendig sein, wieder auf eine klarere Linie zurückzukehren. Die Handelsmarken Standards sind ein Flickwerk, in dem der Eine den Anderern sektoral übertrumpfen will. Der Blick aufs Ganze bleibt dabei trüb. Der EU Bio-Standard ist zu löchrig. Nahezu jede Molkerei unterschreibt bei einem anderen Abnehmer eine andere Vorgabe. Einen gemeinsam gültigen Standard bietet den Biobauern nur der einzige bäuerliche Standard. Und das ist in Österreich jener von BIO AUSTRIA.
Markus Danner
Sebastian Herzog